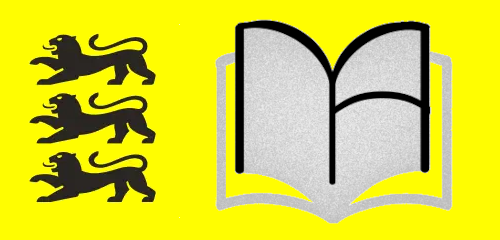Problemlösen AFB II
Eingangklasse
Jahrgangsstufen
BPE 8 Übergreifende Problemlöseaufgaben
Aufgabe 2 Lichtschalterproblem 𝕃
 Ein Hotel hat 100 Zimmer mit den Nummern 1 bis 100 und 100 Gäste. Jedes Zimmer hat einen Lichtschalter, der das Licht einschaltet, wenn es aus ist und es ausschaltet, wenn es an ist.
Ein Hotel hat 100 Zimmer mit den Nummern 1 bis 100 und 100 Gäste. Jedes Zimmer hat einen Lichtschalter, der das Licht einschaltet, wenn es aus ist und es ausschaltet, wenn es an ist.
Zunächst sind alle Lichter ausgeschaltet.
Dann geht jeder Gast der Reihe nach durch jedes Zimmer:
- Gast 1 drückt den Schalter jedes Zimmers.
- Gast 2 drückt den Schalter jedes zweiten Zimmers, also von Zimmer 2, 4, 6, …
- Gast 3 drückt den Schalter jedes dritten Zimmers, also von Zimmer 3, 6, 9, …
- Gast 4…
- …
- Gast 100 drückt den Schalter jedes hundertsten Zimmers, also nur von Zimmer 100.
Beschreibe, wie für ein frei gewähltes Zimmer n (1 ≤ n ≤ 100) geprüft werden kann, ob nach dem Durchgang des letzten Gastes das Licht aus- oder eingeschaltet ist.
(Bonus: Simuliere das Lichtschalter-Problem mit einer Tabellenkalkulation oder mithilfe einer Programmiersprache und überprüfe, welche Lichter nach dem kompletten Durchlauf aus sind. (30min, AB II für Bonus-Aufgabe))
Bild: 4028mdk09, Lichtschalter mechanisch, CC BY-SA 3.0
| AFB II | Kompetenzen K2 K1 K6 K5 | Bearbeitungszeit 20 min |
| Quelle Dr. Andreas Dinh | Lizenz CC BY-SA | |
Aufgabe 2 Türme von Hanoi 𝕃
 Die „Türme von Hanoi“ sind ein altes asiatisches Rätselspiel, welches im 19. Jahrhundert im Westen eingeführt wurde.
Die „Türme von Hanoi“ sind ein altes asiatisches Rätselspiel, welches im 19. Jahrhundert im Westen eingeführt wurde.
Es besteht aus drei am Boden fixierten senkrechten Stäben, von denen zu Beginn die rechte und mittlere Stange unbelegt sind und die linke Stange eine n-stöckige Pyramide enthält, deren Stöcke aus gelochten Scheiben abnehmender Größe besteht. Die Abbildung rechts zeigt eine Holzversion des Spiels mit n=8 Stöcken.
Ziel des Spiels ist, die komplette Pyramide in möglichst wenigen Zügen auf den rechten Stab zu versetzen. Pro Zug darf genau eine Scheibe von einem Stab oben abgezogen und auf einen anderen Stab gesetzt werden. Dabei darf niemals eine Scheibe auf eine kleinere Scheibe abgelegt werden.
Untersuche in Abhängigkeit von n, in wie vielen Zügen N das Spiel optimalerweise gelöst werden kann.
Bild: anonym, Tower of Hanoi, CC BY-SA 3.0
| AFB II | Kompetenzen K2 K4 K5 | Bearbeitungszeit 30 min |
| Quelle Dr. Andreas Dinh | Lizenz CC BY-SA | |
BPE 10.4 Aufstellen von Funktionstermen
Aufgabe 7 Zwei Funktionen mit gemeinsamen Punkten 𝕃
Auf dem Intervall \(]0;6[ \) sollen zwei trigonometrische Funktionen genau fünf gemeinsame Punkte besitzen.
Bestimme zwei mögliche Funktionsterme, für die dies zutrifft. Überprüfe dein Ergebnis.
| AFB II | Kompetenzen K2 | Bearbeitungszeit 15 min |
| Quelle Ingrid Kolupa, Katharina Justice | Lizenz CC BY-SA | |
BPE 12.7 Monotonie
Aufgabe 21 Monotonie 𝕃
f bezeichnet im Folgenden eine im ganzen Definitionsbereich D knickfreie Funktion.
Streng steigende Monotonie ist für f wie folgt definiert:
Wenn für alle \(a, b \in \textbf{D}\) mit \(a<b\) gilt: \(f(a)<f(b)\), heißt f streng monoton steigend.
Aus dem Unterricht wissen wir, dass wir streng steigende Monotonie auch wie folgt untersuchen können:
Wenn für alle \(x \in \textbf{D}\) gilt: \(f'(x)>0\), dann ist f streng monoton steigend.
Zeige mit Hilfe einer geeigneten Funktion f folgende Aussage:
Eine Funktion kann auch dann streng monoton steigend sein, wenn \(f'(x)>0\) nicht für alle \(x \in \textbf{D}\) gilt.
| AFB II | Kompetenzen K2 K1 K5 | Bearbeitungszeit 25 min |
| Quelle Dr. Andreas Dinh | Lizenz CC BY-SA | |
BPE 14.1 Aufstellen von Funktionstermen
Aufgabe 28 Funktionsterme aus Eigenschaften 𝕃
Gegeben sind die folgenden Eigenschaften einer Funktion:
- \(f(2)=f(4)\)
- \(f^{\prime}(3)= 0\)
- \(f^{\prime}(2)\approx 4,7\)
- \[\int\limits_{0}^4 f(x)dx \geq \int\limits_{0}^1 f(x)dx > \int\limits_{0}^2 f(x)dx\]
Bestimme einen Funktionsterm, der alle vier Bedingungen erfüllt.
Inhalt für Lehrende (Anmeldung erforderlich)
| AFB II | Kompetenzen K2 K5 K4 | Bearbeitungszeit 20 min |
| Quelle Problemlösegruppe | Lizenz CC BY-SA | |
BPE 17.1 Zufallsexperimente, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit
Aufgabe 38 Grashalme 𝕃
Ausgangspunkt: Wenn früher in Russland eine junge Frau wissen wollte, ob sie im nächsten Jahr verheiratet sein werde, fragte sie das Grashalm-Orakel: Sie nahm mehrere Paare langer Grashalme in die Faust, so dass sie oben und unten herausragten, und bat eine Freundin, alle Enden oberhalb der Faust irgendwie zufällig, aber paarweise, zusammenzuknoten. Bei allen Enden unterhalb der Faust ebenso. Dann öffnet das Mädchen die Faust.
Falls dabei ein einziger großer Ring aus Gras entsteht, bedeutet dies, dass die junge Frau im nächsten Jahr heiraten werde.
Begründe, dass die Wahrscheinlichkeit bei 2 Paaren, also 4 Grashalmen, durch \(P = \frac{4}{5}\cdot \frac{2}{3}= \frac{8}{15} \approx 53,3 \%\) berechnet werden kann. Berechne damit die Wahrscheinlichkeit, dass bei 3 Paaren, also 6 Grashalmen, ein einziger Ring entsteht.
Inhalt für Lehrende (Anmeldung erforderlich)
| AFB II | Kompetenzen K1 K6 K4 | Bearbeitungszeit k.A. |
| Quelle Stefan Rosner | Lizenz CC BY-SA | |
Aufgabe 40 Nüsse 𝕃
Vor vielen Jahren, als es noch keine Handyspiele gab, spielte man in der Weihnachtszeit beim Nüsse-Essen mit den Nussschalen.
Halbe Nussschalen wurden geworfen und bleiben so ◡ oder so ◠ liegen. Man hat immer zwei halbe Schalen geworfen.
Zwei Nussschalen liegen ◡ ◡ oder ◠ ◠ oder eine ◡ und die andere ◠.
Der Fall ◠ ◠ kam am seltensten vor. Aber die beiden anderen Fälle ( ◡ ◡ und verschiedene Lage) waren etwa gleich häufig.
Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass eine halbe Nussschale in die Lage ◡ fällt.
| AFB II | Kompetenzen K2 K3 K5 | Bearbeitungszeit k.A. |
| Quelle Helmut Diehl, Frenzen | Lizenz CC BY-SA | |
Aufgabe 49 Glücksrad 𝕃
Ein Glücksrad mit einem roten Gewinnbereich von einem Viertel wird so gedreht, dass es in einer völlig zufälligen Position zum Stillstand kommt. Einen Beobachter interessiert, wie groß der Abstand der Halteposition (grünes Dreieck in der Skizze) zum Gewinnbereich ist. Er misst den Abstand in Grad.
So ist der Abstand z.B. 0°, falls das Glücksrad im Gewinnbereich zum Stillstand kommt und 90°, falls es nach einem Drittel oder zwei Dritteln des Verlustbereichs zum Stillstand kommt.
Bestimme mit Hilfe einer geeigneten Zeichnung den Erwartungswert dieses Abstands bei einmaliger Drehung des Glücksrads.
| AFB II | Kompetenzen K2 K4 K5 | Bearbeitungszeit 20 min |
| Quelle Dr. Andreas Dinh | Lizenz CC BY-SA | |